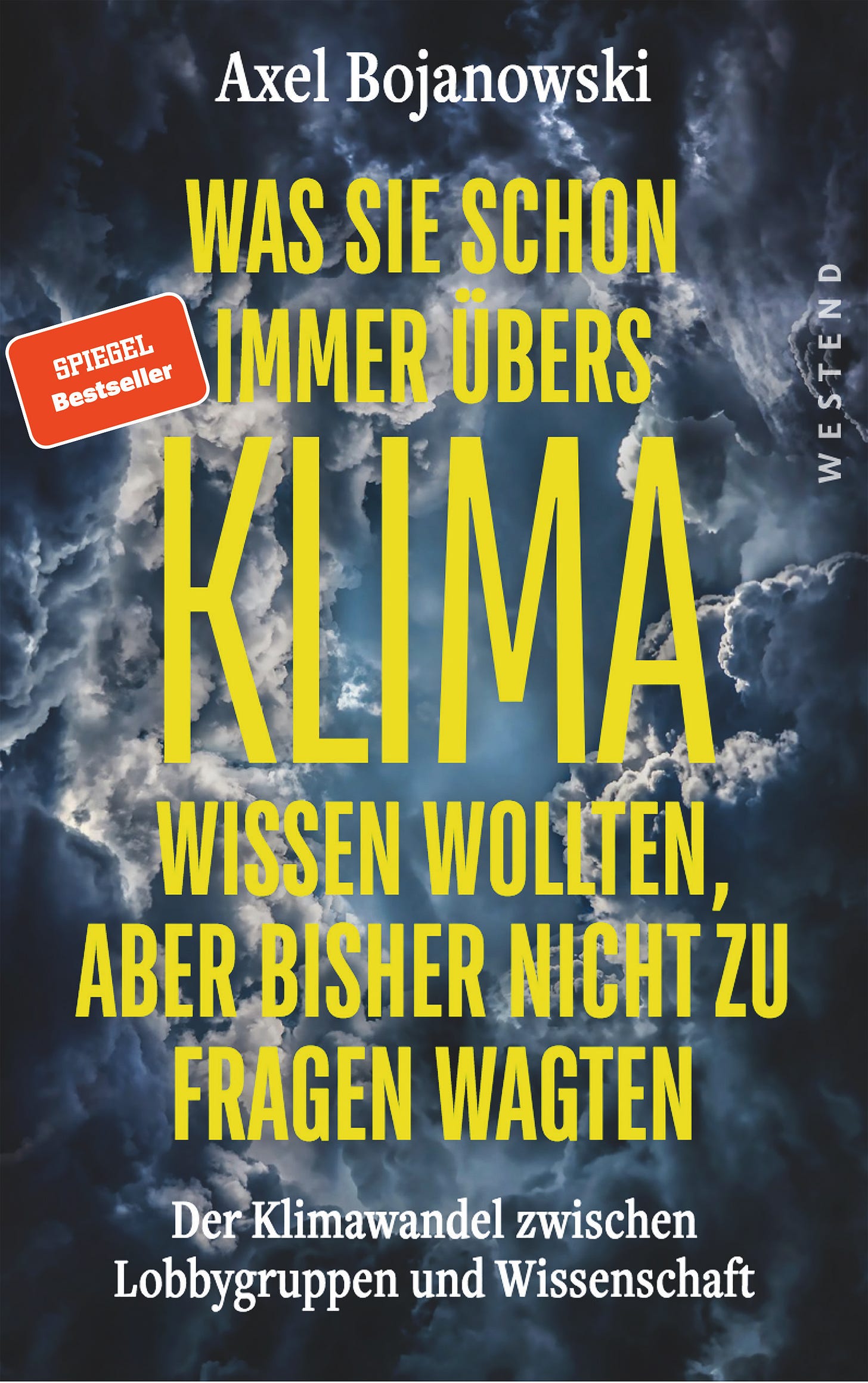Der schnellste Weg zum Geldtopf
Anleitung für den perfekten Antrag auf Fördermittel in der Wissenschaft

Dies ist ein Gastbeitrag von Siegfried Braunbär*, der seit vielen Jahren im Forschungsmanagement die Verteilung von Forschungsmitteln an die Wissenschaft organisiert.
Begehrte Drittmittel
Öffentliche Forschung in Deutschland hängt zum großen Teil an sogenannten Drittmitteln und diese müssen beantragt werden, beim Staat und seinen Organisationen oder bei Stiftungen. Häufige Erfolgsquoten in Förderprogrammen liegen zwischen fünf und zehn Prozent.
Ein Wissenschaftler schreibt also 10 – 20 Anträge auf Förderung um ein Projekt finanziert zu bekommen. Da wäre es natürlich naheliegend, diese Quote zu optimieren. Aber wie geht das?
Die Antwort? Es gibt keine - zumindest keine klare. Förderentscheidungen werden immer durch irgendwelche Entscheidungsprozesse herbeigeführt. Allerdings zeigt die Erfahrung, die Ergebnisse sind zu einem hohen Maß auch vom Glück abhängig, eine Lotterie sozusagen.
Dennoch kann man zumindest in Maßen Fortuna auf unterschiedliche Weise auf die Sprünge helfen.
Das Forschungsthema
Wissenschaftler, die etwas werden wollen, folgen nicht etwa ihrer Intuition oder gar einer kindlichen Neugier. Sie machen heute üblicherweise eine strategische Karriereplanung. Es beginnt mit der Wahl eines angesagten Studienfachs, danach kommt die Spezialisierung innerhalb des Fachs.
Das Renommee der Universität und der Professorenschaft sind wichtig, ebenso die zielführende Platzierung von Praktika und Auslandsaufenthalten. Letzteres dient vor allem dazu, sich für die Stars der Branche zu empfehlen. All diese Entscheidungen liegen im Vorfeld der Geldbeschaffung.
Für eine erfolgreiche Fördermitteleinwerbung ist eine geschickte thematische Positionierung essentiell. Nicht weiter überraschend sind derzeit die Themen globale Erwärmung und erneuerbare Energien hoch im Kurs, idealerweise gepaart mit irgendwelchen Transformationsprozessen.
Verblüffend ist dagegen die Beobachtung, dass praktisch niemand mehr die Auswirkungen gentechnisch veränderter Pflanzen auf das Ökosystem erforscht, obwohl diese Pflanzen weltweit in sehr großem Maßstab angebaut werden. Die Bundesregierung hatte in der Vergangenheit einen dreistelligen Millionenbetrag für diese sogenannte “biologische Sicherheitsforschung” aufgewendet, die Ergebnisse waren eher mager.
Heute kommt es einem karrieremäßigen Selbstmord nahe, sich als junger Wissenschaftler auf dieses Thema zu stürzen, da man kaum etwas finden wird und damit auch nichts zu veröffentlichen hat. Es gilt nach wie vor die alte Devise der organisierten Naturwissenschaft: publish or perish – schreibe oder verschwinde.
Der Name
Sehr viele Wissenschaftler streben nach Prestige, obwohl sie das in den seltensten Fällen zugeben würden. Dabei zielt dieses extrovertierte Verhalten nicht nur auf die Fachwelt, sondern gern auch auf die allgemeine Öffentlichkeit, aber auch auf die Politik.
Die entsprechenden Namen tauchen dann als “invited talk” auf Fachkonferenzen auf, werden durch die Talkshows herumgereicht oder landen in den fachlichen Beratungsgremien der Regierungen. Ein „Name“ ist wie eine Marke, ein Branding – und öffnet Türen.
Manchmal schließen sich diese allerdings auch, denn je höher das Prestige, desto zahlreicher die Neider. Trifft ein Star der Forschung als Antragsteller auf eine andere Koryphäe als Gutachter, könnte die Förderentscheidung schon mal “verzerrt” werden. Man sollte angesichts knapper und begehrter Mittel eben nicht im selben Förderteich fischen.
Die Publikationsliste
Eine Publikationsliste, welche die Zeitschriften „Nature“ und „Science“ möglichst mehrfach enthält, der eigene Name dabei ganz vorn in der Autorenliste (oder falls man schon „Senior“ ist, ganz hinten), erzielt den nötigen Eindruck auf Gutachter.
Auch auf den Publikationsrhythmus wird geachtet. Jährlich ein Artikel sollte es schon sein, besser zwei bis drei, natürlich „peer-reviewed“, also von kritischen Kollegen auf Qualität geprüft.
Ein Wissenschaftler hat einen sogenannten Impact-Faktor, der die Bedeutung seines publizierten Outputs in der Wahrnehmung der wissenschaftlichen Gemeinschaft in einer Indexzahl zusammenfasst. Hochrangige Zeitschriften und ein hoher Impact-Faktor sind hilfreich bei der Einwerbung von Geld.
Die Institution
Im Renommee von Forschungseinrichtungen ist eine Hierarchie zu beobachten, national und international. Ein altehrwürdiges Institut in der Nähe von London oder Boston hat eben ein höheres Prestige als eine Einrichtung aus Bukarest, die möglicherweise auch noch einen unaussprechlichen Namen hat für Menschen, die normalerweise schlechtes Englisch sprechen.
Innerhalb Deutschlands lässt sich dieser Aspekt insbesondere in der Konkurrenz zwischen Hochschulen (= Universitäten) und Fachhochschulen beobachten. Letztere haben sich inzwischen durchweg umbenannt in „University of Applied Sciences“, das klingt im Wettbewerb dann doch imposanter.
Fazit: Geht ein Antrag auf Förderung beim Fördermittelgeber ein kommt nicht selten zuerst die Frage: Wer hat den geschickt? Diese Information nährt Vorurteile darüber, wie sorgfältig der Text zu lesen sei.
Der Antragstext
Das Geheimnis eines guten Antrags ist die Geschichte. Man hat selbst einen guten Namen, gehört zu einer namhaften Institution, ist in einem angesagten Thema unterwegs und man hat die Story – so kommt man weiter.
Die Herausforderung besteht darin, in einer Kakophonie der schrillen Stimmen der Mitbewerber eine klare, einfache Geschichte zu erzählen, nicht zu platt, aber auch nicht zu komplex. Nicht zu verschroben aber schon ein bisschen gaga. Mit einem einleuchtenden Alleinstellungsmerkmal, aber nicht zu exotisch, damit keiner auf die Idee kommt zu sagen: das kann nichts werden.
Von Menschen, die Forschungsanträge lesen, hört man schon mal, sie ertragen das Wort “innovativ” nicht mehr. Es gibt unter Insidern die Empfehlung, es mit der Suchfunktion ersatzlos aus den Anträgen zu streichen, dann wären die Texte gleich merklich kürzer. Alles ist heute innovativ, sprunginnovativ oder gleich disruptiv.
Wir sind umgeben von Herausforderungen, am besten global, planetar oder existenziell. Wir müssen Themenfelder adressieren, Transformationen gestalten und dabei strategische Leitlinien beachten. Das alles sind sogenannte „buzzwords“, die wichtig sein können, aber die Dosis muss stimmen.
Denn eine gute Geschichte allein reicht nicht, sie muss auch gefällig erzählt werden. Wer das Talent hat, alle diese Gegensätze in einen kurzen prägnanten Text zu gießen, der hat schon die halbe Miete.
Die Finanzstrategie
Manche Forscher verfolgen das Aldi-Prinzip: Hauptsache billig. In der Regel funktioniert das nicht gut, auch wenn öffentliche Gelder knapp sind und man denken könnte, wenn Forschungsprojekte billiger wären, bekäme man mehr davon. Für die Förderentscheidung ist es aber wichtig, dass ein Projekt glaubwürdig ist und das bedeutet auch, es darf ruhig etwas kosten.
Ohnehin sind die Gesamtkosten zu drei Viertel und mehr vom Personalaufwand bestimmt und da gibt es kaum Spielräume, denn Forscher in Deutschland werden nach dem TvÖD entlohnt, dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.
Allerdings ist es ein Unterschied, ob ein Doktorand mit einer halben Stelle EG 13/2 abgespeist wird oder ein erfahrener Senior-Wissenschaftler mit voller Stelle bereits in der EG 14/5 agiert – EG heißt Entgeltgruppe. In Zahlen wären das im Bereich des Bundes zur Zeit 2.493,- € vs. 6.754,- € brutto monatlich.
In vielen außeruniversitären Forschungseinrichtungen kommen dazu noch Gemeinkosten von teilweise mehr als 100% auf das Bruttogehalt, sodass für den Steuerzahler für eine volle Wissenschaftlerstelle bis zu 15.000, - € monatlich anzusetzen wären.
Die Kunst liegt nun darin, bei der Antragstellung eine gute Balance zwischen fachlicher Expertise und Personalkosten herzustellen. Der Finanzplan muss glaubwürdig und schlüssig sein und zum vorgestellten Arbeitsplan passen.
Außerdem empfiehlt sich natürlich der Basar-Faktor, d.h. es sind 10-20% Kürzungspotenzial von vorn herein einzuplanen. Man beantragt also 20% mehr als man braucht um dann später bei den Bewilligungsverhandlungen zähneknirschend aber gutwillig 15 % nachgeben zu können.
Die Gutachter
Ein zentraler Widerstand im Wissenschaftsbetrieb sind andere Wissenschaftler. Die öffentliche Hand entscheidet praktisch nie selbst über Fördergelder, ohne sich externe Expertise einzuholen.
Ein Forschungsministerium könnte ohne weiteres seine Förderentscheidungen rein politisch begründen, es ist ja demokratisch legitimiert. Das geschieht aber nicht, die Verteilung von Fördermitteln wird stattdessen fachlich begründet anhand unterschiedlichster Kriterien.
Die Einholung fachlicher Expertise ist das sprichwörtlich weite Feld, vieles ist zu berücksichtigen. Grundsätzlich gilt: Je näher sich ein Gutachter thematisch am Forschungsthema befindet, desto besser sollte er in der Lage sein, dessen Qualität zu beurteilen. Allerdings steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass einem direkten Konkurrenten durch Drittmittel zum Forschungserfolg verholfen werden könnte (ein „Star trifft auf einen anderen „Star“).
Deren Publikationen erscheinen früher, haben den höheren Impact, zudem gibt es Wissenschaftspreise und gern auch weitere Fördermittel. Da könnte man als Gutachter schon mal zögerlich sein im Umgang mit der Konkurrenz.
Im Umkehrschluss bekommen auch Personen Begutachtungsaufträge, die von der Sache wenig bis keine Ahnung haben und diese dennoch wortreich bewerten, irgendwie halt. Ach ja, strenge Vertraulichkeit und die Abwesenheit von Befangenheiten wird selbstverständlich schriftlich zugesichert.
Gutachter sein bedeutet in der Regel kein zusätzliches Prestige, aber jede Menge zusätzliche Arbeit, Reisetätigkeit und keine Vergütung. Wo ist der Nutzen? Tatsächlich gibt es immer noch viele Forscher, die diese Arbeit aus Integrität der Sache und der Allgemeinheit gegenüber auf sich nehmen. Philanthropen im besten Sinne.
Manche sind allerdings schlicht neugierig, was die Szene gerade so ausheckt, man bekommt ja durch Projektskizzen Einblicke aus erster Hand. Was bleibt festzuhalten für die Förderentscheidung?
Die Fachgutachten sind die höchste Hürde und gleichzeitig von fraglicher Qualität. Vielleicht nicht immer, aber viel zu oft. Das Glück spielt für den Antragsteller eine so große Rolle, dass man die Fördermittel auch verlosen könnte, da hätte zumindest jeder die gleiche Chance.
Rampensau oder graue Maus?
Gerade wenn es um viel Geld geht, wollen Fördermittelgeber die Antragsteller gern persönlich kennenlernen. Es werden Gutachterjurys aufgeboten und die Aspiranten zum “Vorsingen” geladen. In der Regel 15 Minuten Präsentation und 15 Minuten kritische Nachfragen.
Wer in so einem Umfeld das Talent von Thomas Gottschalk mitbringt, ist klar im Vorteil. Eine Rampensau halt, die ein Publikum für sich einnehmen kann. Nun sind allerdings Wissenschaftler nicht selten eher die graue Maus aus dem Elfenbeinturm, natürlich auch ein Klischee, aber nicht so weit entfernt von der Realität.
Wer sein berufliches Leben mit komplexen Experimenten und anspruchsvollen Gedanken verbringt entwickelt nicht unbedingt die plapperhafte Leichtigkeit eines Entertainers.
Es sind schon häufiger hochkarätige und aufwändige Projektvorschläge von grauen Mäusen aus dem Rennen gefallen, weil die Rampensau von der Konkurrenz das Feld in einer Viertelstunde aufgerollt hat – auch Gutachter sind empfänglich für die leichte Unterhaltung.
Die Projektträger
Last bald not least muss es Menschen geben, die diese ganzen Prozeduren verwalten und das Geld unter die Leute bringen, wenn die Entscheidung erstmal getroffen wurde. Das sind in Deutschland die Projektträger, international etwas plastischer als funding agencies bezeichnet.
“Projektträger sind in Deutschland Einrichtungen (oder Abteilungen davon), die die Förderung von Projekten organisieren und verwalten. Ihre Auftraggeber sind hauptsächlich Ministerien auf Bundes- und Länderebene”, erklärt Wikipedia. Projektträger sind professionell und neutral, die geballte Fachkompetenz – so sollte man meinen.
Gerüchteweise ist zu hören, dass sich dort gern Menschen ansiedeln, die dem harten Wind des internationalen wissenschaftlichen Wettbewerbs den Rücken kehren möchten und sei es, um eine Festanstellung im öffentlichen Dienst zu ergattern. Wie gesagt, ein Gerücht, nicht belegt.
Allerdings erledigen Projektträger die reale Arbeit und da kann schon mal der Amtsschimmel wiehern. Der perfekte Antrag ist demnach final so zu gestalteten, dass er dem Verwaltungsverfahrensrecht möglichst wenig Widerstände bietet – was kaum ein Wissenschaftler leisten kann. Hier kann der Erfolg davon abhängig sein wie verständig und wohlmeinend derjenige ist, der am Ende den Zuwendungsbescheid unterschreibt.
Fazit
Was kann man aus all dem lernen? Drittmittel sind das Lebenselixier der deutschen und internationalen Wissenschaft. Jeder der sich in eine Forschungskarriere begibt weiß das und muss sich darauf einlassen.
Im Kanon der geschilderten Umstände werden daher die unterschiedlichsten Strategien entwickelt, um die mehr oder weniger lange Phase bis zur ersten Festanstellung zu überleben. Je besser man das System bespielen kann, desto höher die Chancen dafür.
Als Belohnung wartet dann idealerweise eine Position als Forschungsbeamter, auch Professor genannt. Für alle, die es nicht soweit schaffen bleibt immer noch der Plan B: Pharmareferent. Gewesene Wissenschaftler gehen für die Pharmabranche Klinken putzen, weil man hofft, dass der Doktortitel Türen öffnet.
*Der Name des Autors ist ein Pseudonym, unter Klarnamen hätte dieser Text aus naheliegenden Gründen nicht veröffentlicht werden können.
Mein neues Buch über den Klimastreit ist bereits in dritter Auflage erschienen: